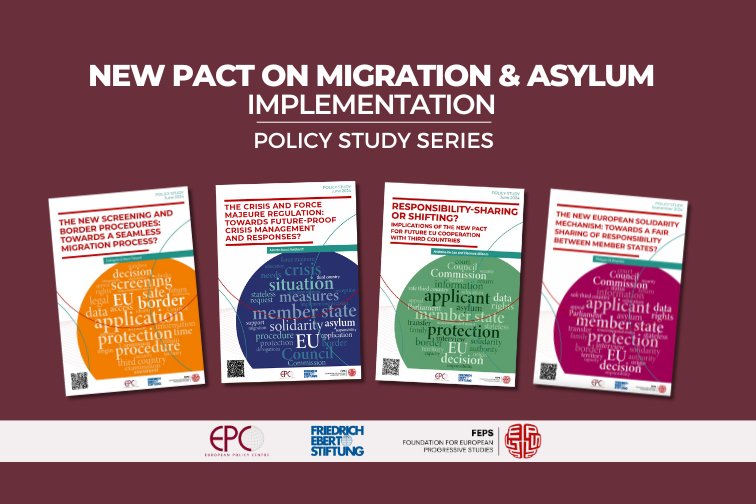#Angekommen | 6. und 7. März 2017 in der FES Berlin
Brunners verpasste Chance
Das Thema Migrationspolitik bestimmte nicht nur den Wahlkampf in Deutschland. Trotz der jüngst verabschiedeten Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) blieb das Thema auch auf EU-Ebene zentral. Neben der nicht abklingenden Debatte um die GEAS-Reform - und unklaren Schritten zur Umsetzung - erhöhen einige Mitgliedstaaten seit Monaten zusätzlich den Druck auf die Europäische Kommission, durch einen neuen Gesetzesvorschlag auch die Abschiebung ausreisepflichtiger Drittstaatsbürger*innen effektiver zu gestalten. Auf einen früheren Vorschlag zu Rückführungen aus dem Jahr 2018 konnten sich das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten nicht einigen. Angesichts des anhaltenden Drucks hat die Kommission schließlich Anfang März einen Vorschlag für eine überarbeitete Rückführungsverordnung vorgestellt. Darüber haben wir mit Birgit Sippel, Mitglied des Europäischen Parlaments für die S&D Fraktion, gesprochen.
Sehr geehrte Frau Sippel, warum haben die Mitgliedstaaten gerade in den letzten Monaten den Druck auf die Kommission erhöht, so schnell wie möglich eine Neufassung der Rückkehrverordnung zu präsentieren?
Birgit Sippel: Viele konservative Regierungen europäischer Mitgliedstaaten verfolgen zunehmend rechtspopulistische Agenden und fordern mehr Abschottung und härtere Maßnahmen, sodass schutzsuchende Menschen möglichst gar nicht erst nach Europa kommen, sondern um jeden Preis abgeschreckt werden. Dabei haben wir erst vor wenigen Monaten nach vielen Jahren der Verhandlungen eine umfangreiche Reform des europäischen Asylsystems beschlossen, die bisherige Regeln verschärft und innerhalb des kommenden Jahres umgesetzt werden muss.
Ich befürchte, diese Umsetzung ist auch Teil der Erklärung, warum so laut nach einem neuen Vorschlag gerufen wurde, denn den Mitgliedstaaten ist wohl klargeworden, wie umfangreich die Umsetzung der GEAS-Reform für Einige wird. Und anstatt sich mit dieser so wichtigen Arbeit zu beschäftigen, deren Auswirkungen wir erst ab Sommer 2026 effektiv wahrnehmen werden, ist es doch deutlich einfacher, immer neue und lautere politische Forderungen in den Raum zu werfen. Dabei geht es mitnichten um wirklich neue Ansätze, sondern es werden alte Konzepte neu verpackt und als innovativ angepriesen. Und das, obwohl viele dieser Ansätze keine echte Lösung für bestehende Herausforderungen bieten.
Was sind denn die zentralen Inhalte dieser neu vorgeschlagenen Rückführungsverordnung?
Es finden sich, wie leider zu erwarten war, kaum positive Aspekte in diesem Vorschlag und die wenigen potenziellen Verbesserungen sind verpasste Chancen. So ist zum Beispiel der grundsätzlich positive Vorschlag für ein Grundrechtemonitoring von Rückführungen viel zu vage gehalten. Dabei gäbe es mit dem Überwachungsmechanismus von Grundrechten in der Screening-Verordnung eine bereits in EU-Recht verankerte Vorlage, auf der man mit etwas gutem Willen einfach hätte aufbauen können.
Stattdessen schlagen die von der Leyen-Kommission und insbesondere der neue Innenkommissar Magnus Brunner unter anderem eine massive Ausweitung der Inhaftierungsmöglichkeiten vor. Die Inhaftierungszeit soll auf zwei Jahre ausgeweitet werden und auch für Kinder und Familien sind keine Ausnahmen vorgesehen. In gewissen Fällen ist sogar unklar, ob es überhaupt eine zeitliche Begrenzung für die Inhaftnahme geben soll. Manche Expert*innen sprechen daher von einer Inhaftierungsverordnung.
Zudem ist der Vorschlag für eine automatische, also verpflichtende, Anerkennung von Abschiebeentscheidungen kritisch zu bewerten, da es durch die GEAS-Reform keine Harmonisierung der Asylentscheidungen gibt – also weiterhin große Unterschiede im Asylprozess und den Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. So könnte es durch die unterschiedlichen Anerkennungsraten bei vergleichbaren Fällen dazu kommen, dass z.B. Deutschland verpflichtet wird, Menschen zurückzuführen, die bei uns eigentlich einen Schutzstatus erhalten hätten.
Zuletzt ist natürlich das Konzept der Abschiebezentren in Drittstaaten hochproblematisch, da sich die rechten Externalisierungsfantasien grundsätzlich als impraktikabel erwiesen und gleichzeitig enorme Summen an Steuergeldern verschlungen haben. Das hat das britische Ruanda-Modell, aber auch Italiens Abkommen mit Albanien, gezeigt. Dieses Geld fehlt dann an allen Ecken und Enden.
Es wird aus dem Kommissionsvorschlag nicht erkenntlich, wie mit Blick auf diese Abschiebezentren in Drittstaaten praktische Hürden überwunden werden sollen. Auch hinsichtlich der grund- und menschenrechtlichen Anforderungen für solche Zentren bleibt der Vorschlag zu schwammig. Zuletzt wird nicht geklärt, was mit den betroffenen Personen in diesen Zentren geschehen soll. Somit wäre es vorstellbar, dass diese auf unbegrenzte Zeit in den Einrichtungen bleiben, unter ungeklärten und höchstwahrscheinlich inakzeptablen Aufnahmebedingungen.
Wie schätzt die S&D-Fraktion im Parlament den Vorschlag ein?
Effektive Rückführungspolitik ist ein Teil eines funktionierenden Migrationssystems. Der Schwerpunkt muss jedoch darauf liegen, wie wir durch engere Zusammenarbeit auf EU-Ebene, sowie durch echte partnerschaftliche Kooperation etwa mit Herkunftsstaaten, einen nachhaltigen, menschenwürdigen und nicht zuletzt auch praktikablen Ansatz für Rückführungen entwickeln können.
Über eine Reform der Rückführungsregeln, die auf diesen Grundsätzen basiert und unsere Grundrechte respektiert, können wir gerne reden. Ob das auf diesen Vorschlag zutrifft, würde ich jedoch stark bezweifeln. Damit hat Innenkommissar Brunner mit seinem ersten Vorstoß in die europäische Migrationspolitik eine echte Chance verpasst und entsprechend schwierig werden die Arbeit an diesem Vorschlag sowie die Verhandlungen in den Trilogen.
Was sind die nächsten Schritte und welche Ergebnisse sind mit Blick auf die neuen Verhältnisse im Parlament, aber auch die Position der neue Regierung Deutschlands im Rat absehbar?
Wir befinden uns noch ganz am Anfang des Gesetzgebungsprozesses und es wäre verfrüht, schon über mögliche Ergebnisse zu spekulieren. Fest steht jedoch, dass es auf unsere sozialdemokratische Fraktion ankommen wird, damit dieser Vorschlag nicht allein einem Geschenk von der Leyens an die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni gleichkommt, sondern tatsächlich in der Praxis einen echten Mehrwert liefert. Angesichts der Zusammenarbeit der EVP-Fraktion mit rechtsextremen Fraktionen, die wir in dieser Legislaturperiode bereits häufiger beobachten mussten, wird dies auch im Parlament eine Herausforderung, der wir uns jedoch mit Vehemenz stellen werden.
Zur Person
Birgit Sippel ist seit 2009 Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Seit 2014 ist sie Sprecherin der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und seit 2022 parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Europäischen Parlament. Sie war und ist Verhandlungsführerin des Europäischen Parlaments für neue Vorschriften zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zu elektronischen Beweismitteln für die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (e-evidence) und ist, nach Abschluss der Verhandlungen für ein Screening-Verfahren von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen, Verhandlungsführerin zur Festlegung von Mindestvorschriften zur Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise bzw Aufenthalt in der EU. Sie ist außerdem Vorsitzende der Arbeitsgruppe zur Implementierung der Asylreform.
Die im Artikel zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Äußerungen der Gastautorin spiegeln nicht notwendigerweise die Haltung der Friedrich-Ebert-Stiftung wider.