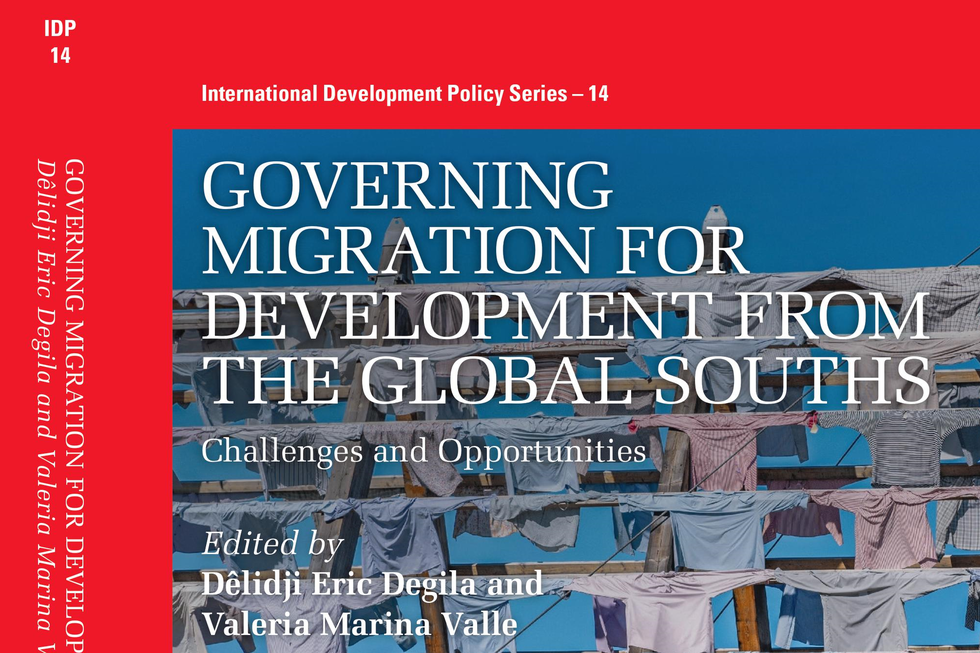Kein Frieden ohne Mobilität
Dem Global Trend Report 2023 des UNHCR zufolge lag die Zahl der aus Venezuela geflüchteten Menschen Ende 2022 bei 5,5 Millionen. Kolumbien hat davon rund 2,5 Millionen Menschen aufgenommen. Beide Länder liegen mit diesen Zahlen weltweit auf einer Spitzenposition. Migration zwischen Venezuela und Kolumbien ist jedoch kein neues Phänomen. Jahrzehntelang waren Kolumbianer_innen vor dem bewaffneten Konflikt in ihrer Heimat nach Venezuela geflohen – im vergangenen Jahrhundert eine der stabilsten Demokratien Lateinamerikas und ein reiches Erdölland. Heute hat sich die Migrationsbewegung umgekehrt, und dabei handelt es sich häufig um Angehörige derselben kolumbianischen Familien, die einst nach Venezuela ausgewandert waren.
Politische Spannungen zwischen den Regierungen sorgen für Gewalt und Vertreibung in der Grenzregion
Kolumbien und Venezuela sind historisch eng verbunden; mit anderen Gebieten bildeten sie im spanischen Kolonialreich das Vizekönigreich Nueva Granada und trennten sich erst nach einem erfolgreichen Unabhängigkeitskrieg. Das Grenzgebiet zwischen beiden ist bis heute eigentlich eine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einheit mit derselben indigenen Bevölkerung auf beiden Seiten, gekennzeichnet durch jahrelange friedliche Pendelmigration. Wegen der Hyperinflation in Venezuela ist heute auch auf der venezolanischen Seite der kolumbianische Peso das gängige Zahlungsmittel.
Die Beziehungen zwischen beiden Ländern verschlechterten sich jedoch dramatisch in der Regierungszeit des kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe (2002-2010). Auf einmal wurde die Grenze bedeutsam, auf beiden Seiten wurde die Militärpräsenz massiv erhöht. In Venezuela kamen die Soldaten meist aus anderen Regionen; sie wurden von der einheimischen Bevölkerung mit Misstrauen empfangen und verdächtigten diese ihrerseits als kolumbianische Spione oder Kriminelle. Einen Höhepunkt fand diese Entwicklung im August 2015 unter Chavez‘ Nachfolger Nicolaus Maduro mit der Ausrufung des Notstandes im venezolanischen Grenzgebiet und der gewaltsamen Vertreibung von Tausenden von Menschen nach Kolumbien. Die Grenze wurde geschlossen und blieb dies bis September 2022.
Migrationsbarrieren als Quelle von Gewalt und Konflikten
Die Grenzschließung hatte nicht nur katastrophale Folgen für den gemeinsamen Wirtschaftsraum. Sie beendete auch nicht die Migration von Venezuela nach Kolumbien, sondern führte nur noch zu mehr Unsicherheit und Gewalt im Zusammenhang mit dieser Migration. Über die zahlreichen Schmugglerpfade wurde jetzt nicht mehr nur mit Waren gehandelt - wie schon immer, denn für die indianische Bevölkerung ist Handel das, was nach der Grenzziehung von den Behörden als Schmuggel bezeichnet wird.
Hinzu kam der Menschenhandel, denn die Ermöglichung des illegalen Grenzübertritts wurde eine wichtige Einkommensquelle für kriminelle Banden und andere bewaffnete Gruppen auf beiden Seiten der Grenze. Seit ihrer Wiedereröffnung im September 2022 hat sich die Lage etwas entspannt; es wird aber dauern, bis sie sich normalisieren wird.
Friedensschluss als Konfliktverstärker im Grenzgebiet
Die Venezolaner_innen wandern nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen nach Kolumbien aus. Sie fliehen auch vor bewaffneter Gewalt. Viele Dörfer auf der venezolanischen Seite sind für internationale Organisationen wie UNHCR oder IOM deshalb nicht zugänglich, nur Vertreter_innen der katholischen Kirche und der Caritas können sie betreten. In das durch die jahrzehntelange Abwesenheit funktionierender ziviler staatlicher Strukturen entstandene Vakuum auf beiden Seiten der Grenze sind nicht nur die bereits erwähnten Militärs und kriminellen Akteure eingewandert, sondern auch - unbeabsichtigte Folge des Friedensschlusses zwischen der Guerillaorganisation FARC und der kolumbianischen Regierung im Jahr 2016 – die kolumbianischen Guerillagruppen, die sich bisher weigern, den bewaffneten Kampf aufzugeben. Die größte Gruppe davon ist die ELN, die, seit Jahrzehnten mit den chavistischen Regierungen in Venezuela verbündet, die venezolanische Grenzregion als Rückzugsgebiet nutzt. Am friedlichsten geht es noch dort zu, wo sie allein herrscht, an anderen Orten kämpft sie mit den anderen Akteuren mit Waffengewalt um Geld und Macht. Opfer ist die Zivilbevölkerung, wie 2021 im venezolanischen Bundestaat Apure, als dort über 5000 Menschen fliehen mussten. Viele Familien gehen auch deshalb auf die andere Seite der Grenze nach Kolumbien, weil sie verhindern wollen, dass ihre Kinder der Guerilla oder den bewaffneten Banden beitreten, die bei der vorherrschenden Perspektivlosigkeit mit Waffen, Autos und Motorrädern für die Jugendlichen attraktiv sind. Zurzeit finden unter venezolanischer Vermittlung Friedensverhandlungen zwischen der ELN und der linksgerichteten kolumbianischen Regierung unter Gustavo Petro statt. Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich diese sind und ob sie zu einer Befriedung des Grenzgebietes beitragen werden.
In einer Untersuchung zur Lage im Grenzgebiet im Rahmen des Projektes PEACEptions der Friedrich Ebert Stiftung zusammen mit dem GIGA (German Institute for Global and Area Studies) über die Interessen und Bedürfnisse der von bewaffneten Konflikten betroffenen Bevölkerung haben viele der Befragten geäußert, sie wünschten sich für ihre Familien ein Dach über dem Kopf, Ruhe, ein Leben ohne Vertreibung, „die Kinder aufwachsen sehen“. Erzwungene Migration bedeutet für sie Schutzlosigkeit und Hilflosigkeit, also das Gegenteil von Frieden. Auf der anderen Seite möchten sie ihre Freiheit zurück, die Grenze nach Kolumbien zu überschreiten, wenn sie es möchten und brauchen.
Über die Autorin

Katharina Wegner ist Juristin, Völkerrecht und Europarecht, und derzeit Leiterin des FES-Büros in Venezuela, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Sie hat in den vergangenen Monaten die Grenzregion zwischen Venezuela und Kolumbien mehrfach besucht.